Die Einführung einer staatlichen elektronischen Identität (eID) in der Schweiz ist eines der zentralen digitalpolitischen Vorhaben der kommenden Jahre. Befürworter preisen die eID als moderne, sichere und freiwillige Lösung zur Vereinfachung von Verwaltungsprozessen an. Kritiker mit IT Fachwissen und oder mit Kentnissen von politischen Prozessen hingegen warnen vor einem schleichenden Zwang, Sicherheitslücken und einer zunehmenden Privatisierung staatlicher Infrastruktur. Wir widerlegen vier zentrale Behauptungen der Befürworter und konfrontiert sie mit dokumentierten Aussagen, technischen Analysen und gesellschaftlichen Implikationen.
1. Die Behauptung der Freiwilligkeit
Die offizielle Kommunikation rund um die eID betont wiederholt deren Freiwilligkeit. Bundesrat Beat Jans erklärte am 12. August 2025 in einer Pressekonferenz: „Die E-ID auf dem Handy sei die Weiterentwicklung der Identitätskarte und ein zusätzliches Angebot.“ Er betonte, sie sei „freiwillig“ und „für diejenigen, die das wollen“.
Die elektronische ID sei ein moderner, vertrauenswürdiger und sicherer digitaler Ausweis.
Beat Jans
Auch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter versicherte: „Die E-ID ist freiwillig.“ Gleichzeitig deutete sie an, dass bestimmte Dienste – etwa der Widerspruch zur Organspende – ohne eID erschwert werden könnten. Freiwillig, aber…
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) formulierte am 14. März 2024: „Die für 2026 geplante elektronische Identität des Bundes ist freiwillig, einfach zu verwenden und bietet grösstmöglichen Schutz der Privatsphäre.“
Diese Aussagen stehen jedoch im Widerspruch zur praktischen Entwicklung. Kritiker warnen: „Freiwillig“ ist nur so lange freiwillig, bis Behörden oder Firmen ohne E-ID keinen Zugang mehr gewähren“
Beat Jans verkauft die E-ID als «Weiterentwicklung der Identitätskarte», verschweigt aber, dass es sich um die digitale Eintrittskarte in ein System handelt, das später beliebig ausgebaut werden kann. «Freiwillig» ist nur so lange freiwillig, bis Behörden oder Firmen ohne E-ID keinen Zugang mehr gewähren.
Daniel Gugger
Die Plattform e-id-gesetz-nein.ch weist darauf hin, dass ein „Offline-Recht“ nicht garantiert sei. Bürgerinnen und Bürger könnten gezwungen werden, digitale Dienste zu nutzen, um grundlegende Verwaltungsakte zu vollziehen. Die Parallelen zum Corona-Zertifikat, das ursprünglich als freiwillig galt und später Zugangsbeschränkungen mit sich brachte, sind offensichtlich.
2. Die Behauptung absoluter Sicherheit
Ein weiteres zentrales Argument der Befürworter ist die angeblich hohe Sicherheit der eID. Beat Jans erklärte gegenüber der Zeitung 20 Minuten, Identitätsmissbrauch sei „praktisch unmöglich“.
Identitätsmissbrauch könne «nach heutigem Stand der Technik» im vorgesehenen System «praktisch verunmöglicht» werden, betont der Stadtbasler weiter.
Beat Jans
Das EJPD versichert: „Die eID bietet grösstmöglichen Schutz der Privatsphäre.“
Diese Aussagen suggerieren eine nahezu perfekte technische Lösung. Doch Sicherheit ist kein absoluter Zustand. Jede Software kann Schwachstellen enthalten – insbesondere, wenn der Quellcode nicht öffentlich einsehbar ist. Kritiker wie @AGForensik widersprechen der Darstellung: „Der gesamte Quellcode aller e-ID-Systeme kann gemäss e-ID-Gesetz geheimgehalten werden“. Dies widerspricht etablierten Sicherheitsstandards, die Transparenz und Open Source als Grundpfeiler moderner IT-Sicherheit betrachten.
Zudem wird im Gesetz die Technologie des „Gesichtsbildabgleichs“ festgelegt – eine Methode, die angesichts der rasanten Entwicklung von Deepfakes als nicht zukunftssicher gilt. Auch die Plattform e-id-gesetz-nein.ch warnt: „Die technische Infrastruktur der E-ID beinhaltet ein bekanntermassen hacking-anfälliges System zur Video-Identifikation. Dass dieser Teil der Software nicht Open Source ist, widerspricht wissenschaftlich belegten Security Standards.“
Daniel Gugger ergänzt: „Schnittstellen, Zertifikate oder Updates reichen, um massenhaft Zugriff zu erlangen“. Die Haftung im Missbrauchsfall liegt beim Nutzer – ein Umstand, der in der öffentlichen Kommunikation kaum thematisiert wird.
3. Die Behauptung vollständiger Staatlichkeit
Nach der Ablehnung des ersten eID-Gesetzes im Jahr 2021 betonen Befürworter nun, dass die neue Lösung vollständig staatlich sei. Die offizielle Kampagne spricht von „100 % staatlich“. Beat Jans lehnt eine Privatisierung ab und betont die staatliche Kontrolle.
Doch die Realität ist komplexer. Die Firma ELCA soll die Online-Verifikation übernehmen – ein privates Unternehmen, dessen Software nicht Open Source ist (Quelle: Pierre Moret). Die Serafe AG, zuständig für die Medienabgabe, gehört der Secon AG, die wiederum mit ELCA verbunden ist. Diese Verflechtungen werfen Fragen zur tatsächlichen Unabhängigkeit und Kontrolle auf.
Die Plattform e-id-gesetz-nein.ch warnt: „Das E-ID-Gesetz verschafft Big Tech und der Überwachungsökonomie erleichterten Zugriff auf die Passdaten der Bevölkerung.“ Die wirtschaftlichen Interessen privater Anbieter stehen im Widerspruch zur versprochenen staatlichen Souveränität.
Die Schweiz verliert Millionen an Investitionen und hunderte Arbeitsplätze, nur weil der Bundesrat die Rechtssicherheit untergräbt mit den Plänen zur Massenüberwachung und der ständigen Identifikation der Bürger im Netz.
Verfassungsschutz und Forensik
Quelle: Verfassungsschutz und Forensik
4. Die Behauptung eines verbesserten Ansatzes nach 2021
Nach der Volksabstimmung von 2021, bei der die damalige eID klar abgelehnt wurde, argumentieren Befürworter, dass der neue Ansatz verbessert sei.
Das Produkt und der Prozess dahinter sind besser als 2021.
Beat Jans
Diese Aussage suggeriert, dass die damalige Ablehnung lediglich der privaten Umsetzung galt. Zudem ist verbessert nicht sicher. Kritiker widersprechen.
Es ist kein Zufall, dass alle westlichen Staaten fast gleichzeitig Altersverifikation und Digital-ID ausrollen. Die Informationskontrolle wird international koordiniert.
Verfassungsschutz und Forensik
Quelle: Verfassungsschutz und Forensik
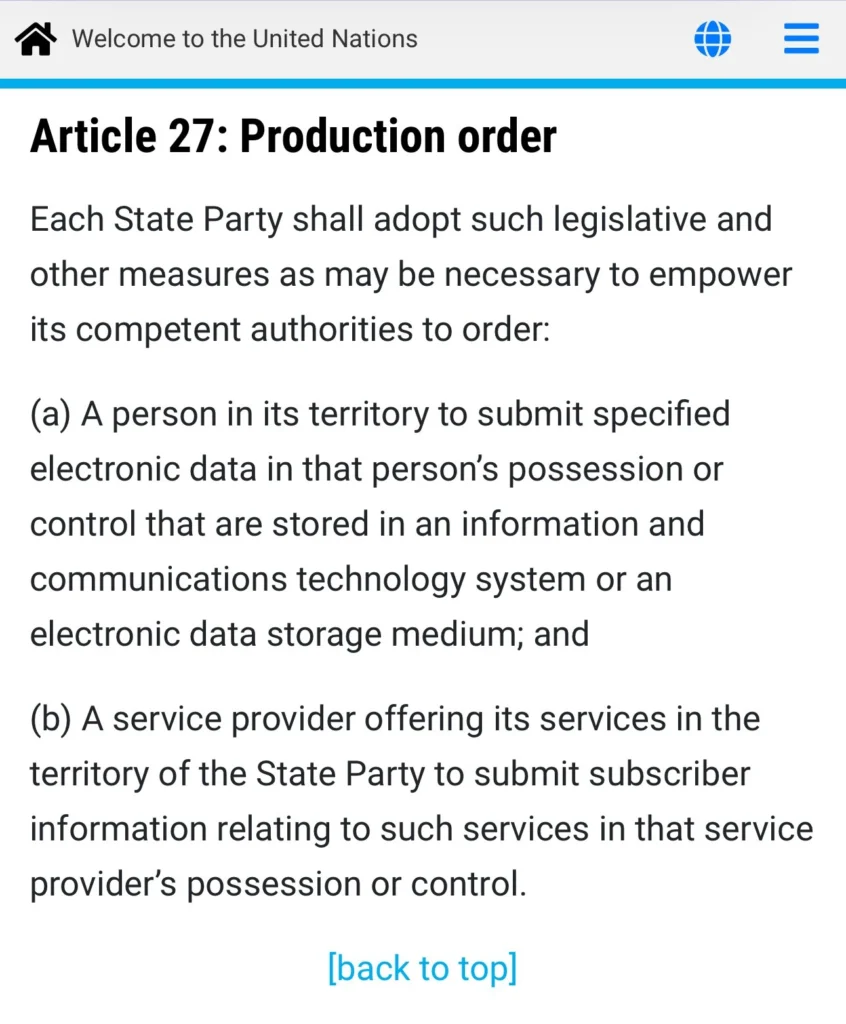
Ein Vergleich mit dem Vereinigten Königreich zeigt ähnliche Entwicklungen: Auch dort wird die Einführung digitaler Identitäten mit dem Argument der Modernisierung vorangetrieben, während gleichzeitig Bedenken hinsichtlich Datenschutz, sozialer Teilhabe und technischer Sicherheit täglich lauter werden.
Der Artikel zeigt die vier grössten Lügen zur eID auf – oder nicht?
Die Analyse zeigt, dass zentrale Aussagen zur eID – Freiwilligkeit, Sicherheit, Staatlichkeit und Verbesserung gegenüber 2021 – einer kritischen Prüfung nicht standhalten.
Die eID ist keineswegs vollständig freiwillig, sondern könnte durch funktionale Einschränkungen und sozialen Druck faktisch verpflichtend werden. Die Sicherheit ist nicht absolut, insbesondere bei fehlender Transparenz und privater Beteiligung. Die versprochene Staatlichkeit wird durch die Einbindung privater Unternehmen relativiert. Und die angebliche Verbesserung gegenüber dem 2021 abgelehnten Modell betrifft nur Teilaspekte, nicht jedoch die grundlegenden Bedenken.
Für uns Bürger stellt sich die Frage, ob die eID in ihrer geplanten Form tatsächlich dem Gemeinwohl dient – oder ob sie ein weiterer Schritt in Richtung digitaler Kontrolle und wirtschaftlicher Verwertung persönlicher Daten ist. Eine informierte, kritische Auseinandersetzung ist unerlässlich.
Die Abstimmung am 28. September 2025 wird nicht nur über ein technisches System entscheiden, sondern über die digitale Zukunft der Schweiz.
Wenn Sie diesen Beitrag wichtig finden, erzählen Sie es Ihren Freunden, Bekannten und teilen Sie den Beitrag auf sozialen Medien, in Gruppen oder Chats. Eine informierte Öffentlichkeit ist der beste Schutz vor digitaler Entmündigung und dem folgendendem Social Scoring.

